🔍 Ein Thema, das bewegt.
Warum wir über Kriminalität in der DDR reden sollten – und wie.
Kaum ein Thema ruft derzeit so viele Reaktionen hervor wie der Vergleich zwischen Kriminalität "damals" und "heute". Ob in persönlichen Gesprächen, in Kommentarspalten oder auf Social Media – viele Menschen, insbesondere ehemalige DDR-Bürgerinnen und -Bürger, sprechen offen darüber, wie sicher sie sich früher gefühlt haben. Häufig hört man Sätze wie:
"So was gab’s bei uns nicht"
oder:
"Da konnte man nachts ohne Angst nach Hause gehen."
Natürlich ist das Thema emotional aufgeladen – von Ostalgie bis Verklärung, von West-Skepsis bis politischem Generalverdacht. Genau deshalb lohnt es sich, genauer und sachlicher hinzusehen: Was stimmt wirklich? Welche Faktoren spielten eine Rolle? Und wo hört das Wunschbild auf und beginnt die Realität?
Dieser Artikel versucht eine ehrliche, nüchterne Bestandsaufnahme: Wie war es wirklich mit der Kriminalität in der DDR? Und warum war manches – ganz unabhängig von Ideologie – tatsächlich anders als heute? Abbildung: Ohne Angst oder "komische Gefühle" an öffentlichen Plätzen verweilen (wie hier in der Prager Straße in Dresden, Ende der 1970er) – eine negative Veränderung des Lebensalltags, die oft von ehem. DDR-Bewohnern thematisiert wird.
Abbildung: Ohne Angst oder "komische Gefühle" an öffentlichen Plätzen verweilen (wie hier in der Prager Straße in Dresden, Ende der 1970er) – eine negative Veränderung des Lebensalltags, die oft von ehem. DDR-Bewohnern thematisiert wird.
🧯 Sicherheit statt Chaos?!
Warum es in der DDR weniger Gewaltverbrechen gab – und was dahintersteckte:
Wenn man die DDR mit dem heutigen Sicherheitsgefühl in vielen westlichen Städten vergleicht, überrascht ein Punkt besonders: In der Deutschen Demokratischen Republik gab es – statistisch wie gefühlt – weniger Gewalt, weniger Raubüberfälle und deutlich weniger schwere Verbrechen. Natürlich war die DDR kein kriminell freier Ort, und manche Zahlen wurden bewusst geschönt. Aber viele Befunde halten auch einer ehrlichen Prüfung stand – nicht trotz, sondern wegen der spezifischen gesellschaftlichen Struktur.

Abbildung: Das "soziale Milieu" ist ein wesentlicher Faktor bei der Entstehung von Kriminalität, aber auch beim subjektiven Sicherheitsgefühl (hier: eine typische Hausgemeinschaft im "Neubau" – Muttis sozialisieren, während ihre Kinder zusammen spielen)
🧱 Sozialismus statt Milieu?!
Warum Armut und Elend als Kriminalitätsursachen weitgehend ausfielen:
In der DDR gab es keine offene Obdachlosigkeit, keine Arbeitslosigkeit, keine überteuerten Mieten, keine Drogenhöllen. So salopp das formuliert ist, so wahr ist es eben auch. No-Go-Areas oder Bahnhöfe, an die sich Frauen nachts nicht mehr trauten: Solche Dinge waren unbekannt.
Fakt war auch: Jeder hatte einen Beruf – wenn auch nicht immer den Wunschberuf – und eine Wohnung, wenn auch nicht im Wunschzustand. Existenzielle Not, wie sie in westlichen Brennpunkten viele zur Beschaffungskriminalität trieb und treibt, war strukturell ausgeschlossen. Die wichtigsten Lebensbereiche waren – bei Einschränkungen – gesichert: Bildung, Gesundheitsversorgung, Wohnraum, Grundnahrung.
Das Ergebnis: Weniger Kleinkriminalität (aber: Diese war selbstverständlich vorhanden!), kaum organisierte Kriminalität und praktisch keinerlei Clan- oder Bandenstrukturen. Abbildung: So sah "Hausgemeinschaft" in der (heute viel geschmähten) "Plattenbausiedlung" aus. Hier: Ein Hausgemeinschaftsfest Angang der 1980er in Leipzig
Abbildung: So sah "Hausgemeinschaft" in der (heute viel geschmähten) "Plattenbausiedlung" aus. Hier: Ein Hausgemeinschaftsfest Angang der 1980er in Leipzig
👁 Soziale Kontrolle als Kriminalprävention?!
Wenn jeder jeden kennt – und vielleicht auch beobachtet:
Ein entscheidender Faktor für das geringe Kriminalitätsaufkommen lag in der engmaschigen sozialen Kontrolle. Das ist ein Faktor, den man nicht schönfärberisch negieren sollte. Für Menschen, die nicht in der DDR lebten, ist dies am besten vergleichbar mit einem kleinen, urtümlichen Dorf: Auch hier bleibt wenig verborgen. Und bekanntermaßen sind in dieser kleinen Dorfgemeinschaft auch Alarmanlagen überflüssig: Sie werden ersetzt durch jede Menge aufmerksame ältere Damen...
Tatsächlich war die Gesellschaft in der DDR aber genauso strukturiert, und zwar nicht nur auf dem Dorf: Die Nachbarschaft war keine anonyme Masse wie im Westen, sondern ein funktionierendes Kollektiv. Jeder kannte seinen ABV – den Abschnittsbevollmächtigten der Volkspolizei. Er wusste, wer arbeitslos war (was eigentlich nicht vorkommen sollte, und tatsächlich fast ausschließlich aus dem Verhalten des "Werktätigen" resultierte. Die DDR kannte so etwas wie "Kündigungen" nicht.), wer trank, wer nachts laut war. Hausgemeinschaften, Betriebsleitungen, FDJ-Gruppen: Überall gab es Strukturen, die auffälliges Verhalten früh meldeten. Und hier ging es in erster Linie um sozial nicht kompatibles Verhalten: häusliche Gewalt, Alkoholmissbrauch, Diebstahl, Vandalismus usw..
Die Kehrseite: Der Eine oder die Andere fühlte sich unter Umständen in seiner Freiheit eingeschränkt. Doch die Wirkung auf die Sicherheit im Alltag war deutlich spürbar – besonders für die meisten Bürger. Und (auch aus heutiger Sicht) gilt es hier immer abzuwägen: Die persönliche Freiheit endet nun mal da, wo sie die Freiheit eines anderen bedroht. Dazu gehört beispielsweise auch die Freiheit, 8 Stunden ungestört durchzuschlafen...

Abbildung: Mehr als nur Klischee – dem ABV konnte Mutti auch mal das Kind anvertrauen, während sie einkaufen war, sofern er in der Nähe war...
🔍 Repression oder Prävention: ein System mit Doppelfunktion?!
Natürlich spielte auch die Form der Justiz eine Rolle. Die Justiz und der Strafvollzug waren streng. Politisch Andersdenkende wurden unter Umständen (faktisch aber sehr selten!) kriminalisiert. Doch daneben gab es eine ausgeprägte Präventionspraxis: Jugendliche mit "abweichendem Verhalten" (sogenannte "Rowdys") wurden früh erfasst, oft mit betreuender Maßnahme statt harter Strafe. Der Staat verstand sich nicht nur als Richter, sondern als Erzieher.
In den allermeisten Fällen hieß das: Keine Anzeige, sondern ein strenger Verweis, ein "erzieherisches Gespräch", ein Aufbauseminar.
Im Vergleich zur BRD: In vielen westlichen Justizsystemen ist bis heute zu beobachten, dass Jugendliche durch Inhaftierung in Justizvollzugsanstalten häufig weiter kriminalisiert werden – Stichwort: Kriminalitätskarrieren, die im Gefängnis erst richtig beginnen. Die DDR hingegen versuchte – mit ideologischem Unterton, aber ernst gemeint – die Resozialisierung vor die Strafe zu stellen.
Konstruktiver DDR-Ansatz? Trotz berechtigter Kritik an Zwang, Kontrolle und Missständen in einigen Einrichtungen, lässt sich argumentieren:
Der Grundansatz, Jugendliche nicht einfach „einzusperren“, sondern sie aktiv umzuerziehen und gesellschaftlich zu integrieren, war potenziell nachhaltiger – insbesondere in einem System mit hoher sozialer Kontrolle, klaren Strukturen und kollektivistischen Leitbildern.

Abbildung: Nie weit weg und immer Respektsperson – ein Volkspolizist kontrolliert eine Baustelle Anfang der 1980er
📉 Faktenlage: Gewaltverbrechen? Kaum.
Die offiziellen Statistiken wiesen deutlich niedrigere Fallzahlen bei Kapitalverbrechen auf – und viele Experten bestätigen das Grundmuster:
- Tötungsdelikte: Etwa 2 pro 100.000 Einwohner (BRD: ca. 4)
- Raubüberfälle: Selten – kaum Waffenbesitz, wenig Bargeld im Umlauf
- Sexualverbrechen: Gering, aber auch untererfasst (Tabuisierung)
Auffällig: Während in der BRD in den 1980ern Jugendgangs, Rocker und Drogenmilieus, aber auch Clan-Kriminalität und mafiöse Strukturen wuchsen, blieb die DDR davon verschont. Es gab schlicht keine Drogenszene, keinen Schwarzmarkt für Waffen, kein westliches Nachtleben, das entgleiste.
⚖️ 3. Gewaltverbrechen – Mord & Totschlag:
Von 1969 bis 1989 wurden insgesamt 2.263 Fälle von Mord/Totschlag offiziell registriert
Das entspricht einer jährlichen Mordrate von etwa 0,8 pro 100.000 Einwohner, deutlich niedriger als Westdeutschland (2–4 pro 100.000).
📉 4. Gesamtkriminalität:
Für das Jahr 1989 wurden 99.971 Straftaten gemeldet – das ergab bei ~16 Mio Einwohner rund 625 Straftaten pro 100.000 Einwohner.
Im Vergleich verzeichnete die BRD zur selben Zeit deutlich höhere Werte – oft über 5.000 Delikte pro 100.000 Einwohner.
🔍 5. Datenlage & politische Einflüsse:
-
Relativierender Fakt: Viele Deliktarten (z.B. Bagatelldiebstahl, Beleidigung) wurden nach 1968 aus Statistiken herausgenommen.
-
Es gibt durchaus ernstzunehmende Hinweise, dass politisch unerwünschte Fälle – z. B. Suizide oder staatliche Gewalt – in der DDR unvollständig veröffentlicht wurden.
-
Wichtig ist: Zahlen sind nur ein Teil der Wahrheit – persönliche Erinnerungen und qualitative Quellen ergänzen entscheidend. Denn wie so oft: Haben beide politische Systeme (BRD und DDR) eigene Interessen im Kontext der Darstellung ihrer Kriminalitätsraten.

Abbildung: Seltenes Foto eines Helikopters der Volkspolizei (Anfang 1980er), oft zur Leipziger Messe im Kontext der Verkehrsaufklärung im Einsatz
🔍 Offizielle Aufklärungsquote in der DDR
-
Durchschnittlich 80–90 % laut staatlicher Angaben.
- Besonders bei Diebstahl, Einbruch und Körperverletzung wurden hohe Quoten gemeldet.
-
Mord und schwere Gewaltdelikte galten fast immer als vollständig aufgeklärt – auch, weil sie sehr selten vorkamen.
- BRD-Aufklärungsquote lag in den 1980ern bei etwa 40–50 %, bei Mord höher (ca. 95 %).
📌 Valide offizielle Quellen zur Kriminalitäts- und Aufklärungsstatistik in der DDR
Die wichtigste valide Quelle zum Thema "DDR-Kriminalitätsrate"ist: "Lagebild zur Kriminalitätsentwicklung in der DDR"
- herausgegeben jährlich vom Ministerium des Innern (MdI)
- enthielt detaillierte Daten zu Straftaten, Aufklärungsquoten, Tätergruppen etc.
- nur für den internen Dienstgebrauch (VVS) bestimmt
- diente der Berichterstattung an die SED-Führung und Polizeioberen
- ergänzt durch interne Berichte der Deutschen Volkspolizei (DVP) und teilweise durch Daten der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik (SZS)
➡️ Diese Berichte gelten heute als die verlässlichsten offiziellen Quellen, gerade weil sie nicht öffentlich waren. Manche davon wurden nach 1990 von Historikern und Archiven (z. B. BStU, Bundesarchiv) erschlossen und verifiziert.
Weitere valide Quellen: Forschungsarbeiten von Helmut Staubmann, Jens Gieseke, oder "DDR-Kriminalität" von B. Großmann.
📉 1. Zahlenmanipulation: Nur ein DDR-Thema?
Die Zahlen der BRD basierten auf der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) – diese erfasst nur angezeigte Fälle, nicht tatsächliche Delikte. Das führt zu:
- Großem Dunkelfeld: Viele Straftaten (v. a. häusliche Gewalt, Sexualdelikte, Drogenhandel, Korruption) blieben und bleiben ungemeldet.
- Politische Interpretation: Ein Rückgang in den Zahlen heißt oft nur: weniger Anzeigen, nicht weniger Taten.
- Polizei meldet, Staatsanwaltschaft prüft nicht mit – reine Eingangsstatistik.
👉 Das führt zu einer großen strukturellen Verzerrung – besonders bei politisch brisanten Themen. Zu 100% verlässlich waren und sind also die Zahlen zur Kriminalitätsstatistik der BRD kaum.
Abbildung: Öffentliche Plätze erscheinen ehemaligen DDR-Bürgern in der Erinnerung subjektiv früher oft sauberer und sicherer. Hier: Sommer in Berlin ( Am Lindencorso), Anfang der 1980er
🛑 2. Politischer Druck in Städten und Bundesländern:
Ein faktischer Blick in die Gegenwart zeigt: In mehreren Fällen wurden auch vor nicht allzu langer Zeit Vorgesetzte in Polizei oder Innenbehörden unter Druck gesetzt, Kriminalitätszahlen in Städten wie Köln, Frankfurt, Berlin oder Hamburg "kommunikativ einzudämmen".
Beispiel Köln 2015: Nach den Übergriffen in der Silvesternacht wurden interne Versuche bekannt, Lageberichte zunächst zu entschärfen.
Beispiel Berlin-Neukölln: Verschiedene Bürgermeister sprachen öffentlich von einem "politischen Tabu", No-Go-Areas oder Clan-Kriminalität klar zu benennen, weil dies als integrationsfeindlich gelten könne.
Diese realen Beispiele aus der Gegenwart für eine bewusst verzerrte Kommunikation von Sicherheitslage und Kriminalität lassen durchaus vermuten, dass Ähnliches (politisch motiviert) auch in der BRD der Vor-Wende-Zeit passierte.
🧠 Zahlenglaubwürdigkeit: das Fazit.
Auch in der BRD waren und sind Kriminalitätszahlen nicht neutral, sondern abhängig von Anzeigeverhalten, Polizeipraxis und politischer Kommunikation.
Während in der DDR offenbar systematisch verschwiegen wurde, ist es in der BRD eher eine Frage von Ausblendung, Gewichtung und Kontext.
Beides resultiert am Ende in: Manipulation.
Statistik ist ein Werkzeug – und wie jedes Werkzeug kann es politisch genutzt werden. Wer sich kritisch und differenziert mit den Kriminalitätszahlen der DDR beschäftigt, sollte den Blick konsequenterweise auch auf ähnliche Entwicklungen in der Bundesrepublik richten – sowohl historisch als auch mit Blick auf die Gegenwart. Das verlangt nicht nach Relativierung, sondern nach faktenbasierter Sachlichkeit und journalistischer Fairness. Nur ein Vergleich beider Systeme – unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen – ermöglicht eine seriöse Einordnung.

Abbildung: Zur Identifikation mit dem eigenen Viertel gehörte in der DDR auch, mit "anzupacken". Das "Anpacken" begann fast überall mit der Anlage und Pflege von Grünanlagen oder Blumenbeeten.
🔒 Tabus und tote Winkel in der DDR:
Was man in der DDR lieber verschwieg: Nicht alles war so harmlos, wie es die Zahlen nahelegen. Häusliche Gewalt, sexueller Missbrauch, vereinzelte Gewalt in Heimen oder Jugendwerkhöfen (die es, das muss man fairerweise herausstellen, auch in der BRD im hohen Maße gab) wurden selten öffentlich benannt oder aufgearbeitet. Hier zeigt sich leider das doppelte Gesicht des Systems: Sicherheit für viele – aber Schweigen über Gewalt gegen wenige.
🧭 Fazit: Weniger Freiheit, mehr Sicherheit?
Die DDR war kein Paradies – das behauptet aber auch niemand. Sie war aber eben auch kein krimineller Staat. Und auch kein "Unrechtsstaat" (ein Terminus, der sich leider medial unterstützt mittlerweile gefestigt hat).
Im Gegenteil: Die Alltagskriminalität war gering, Gewaltverbrechen sehr selten. Die Gründe lagen eben nicht allein in staatlicher Kontrolle, sondern auch in einem funktionierenden sozialen Netz, sozialer Einbindung und (quasi nicht zu überbietender) Lebenssicherheit.
Das schuf ein Maß an Ordnung, das viele Menschen heute offenbar in (v.a. vielen westlichen) Großstädten schmerzlich vermissen.
Sicherheit war kein Zufall – sondern System.
Und zu diesem System gehören auch Innovationen, die manch ein Bürger vielleicht damals als lästig empfand, die aber mit zeitlichem Abstand heute als innovativ und sinnvoll angesehen werden können. Als bestes Beispiel sei hier die Institution des "ABV" genannt.
Abbildung: Reizthema "Freibad" – auch in großen DDR-Freizeitbädern war oft nur ein Bademeister zugange. Und der war: Respektsperson. Security oder zusätzliche Sicherheitsleute kannte man dort nicht.
👮Der ABV – Nähe statt Distanz.
Wie der Abschnittsbevollmächtigte Sicherheit und Ordnung im Alltag garantieren sollte:
In der DDR war der Abschnittsbevollmächtigte der Volkspolizei, kurz ABV, eine zentrale Figur des öffentlichen Lebens. Anders als heute viele Polizisten, war der ABV sichtbar, ansprechbar und persönlich bekannt. Er war nicht nur Gesetzeshüter, sondern Vertrauter, Ansprechpartner und Vermittler – und das ganz bewusst.
Jeder ABV betreute einen festen Wohnbereich, meist ein paar Straßen oder einen Stadtteil. Er kannte "seine" Menschen – vom Rentner bis zur Jugendgruppe, vom Hauswart bis zur Schuldirektorin. Schlicht, weil sie seine Nachbarn waren. Er wusste, wer wo wohnt, wer Hilfe braucht, wer auffällt – aber auch, wer einfach mal reden möchte.
Der ABV war nicht Repressionsfigur (auch wenn es hier sicher menschliche Ausnahmen gab!), sondern verstand sich als sozialer Ordnungshüter. Sein Auftrag lautete, vorbeugend zu wirken, Streit zu schlichten, Jugendlichen Orientierung zu geben und Konflikte möglichst ohne Anzeige zu lösen. Er arbeitete eng mit Hausgemeinschaften, Schulen und Betrieben zusammen – und war oft früher da als die Probleme selbst.
Viele Menschen erinnern sich bis heute an "ihren" ABV als jemanden, der Präsenz zeigte, ohne zu drohen. Der Vertrauen schuf, weil er regelmäßig vor Ort war, nicht nur im Einsatzwagen vorbeifuhr. In einem System, das auf Nähe, Kontrolle und sozialer Verantwortung beruhte, war der ABV die personifizierte Schnittstelle zwischen Staat und Nachbarschaft – eine Mischung aus Schutzmann, Zuhörer und Mahner.
Klar: Auch der ABV war Teil eines Systems, das politisch funktionierte. Doch in der praktischen Alltagserfahrung vieler DDR-Bürgerinnen und -Bürger war er weniger ein Repräsentant der Macht als ein Teil der Gemeinschaft. Ein Mensch mit Uniform, ja – aber auch mit Kaffeetasse, Gesprächsoffenheit und manchmal einem guten Rat.
Abbildung: Man kannte sich – so wie hier beim Stadtteilfest in Berlin Prenzlauer Berg, Mitte der 1980er.
🤝 Weniger urteilen, mehr zuhören: Die DDR aus erster Hand verstehen.
Vielleicht lohnt sich ein nüchterner Blick auf das, was trotz aller Mängel funktionierte. Manches lässt sich nicht zurückholen – aber verstehen kann man es. Die Erinnerung an ein Leben mit weniger Angst ist kein Mythos, sondern Teil einer erfahrbaren Realität vieler Menschen.
Weniger Angst bedeutete nicht weniger Staat – sondern mehr Nähe.
Es waren andere Zeiten – doch das Bedürfnis nach Sicherheit ist geblieben. Man kann vieles hinterfragen – aber das Gefühl, sicher gewesen zu sein, ist für viele unvergessen. Heute gibt es mehr Freiheit – aber nicht unbedingt mehr Vertrauen. Sicherheit damals hatte ihren Preis – aber sie war spürbar.
Und vielleicht wäre es ohnehin klug, öfter einfach miteinander zu sprechen – statt übereinander. Wer mehr über das Leben in der DDR wissen will, ist herzlich eingeladen, ehemalige DDR-Bürgerinnen und -Bürger direkt zu fragen: Wie war das damals wirklich? Was empfandet ihr als sicher, als gerecht, als bedrohlich oder als wohltuend?
Denn allzu oft stammen unsere vermeintlichen „Informationen“ aus politisch gefärbten, westlich geprägten Mediennarrativen, nicht aus persönlicher Erfahrung. Ein ehrliches Gespräch bringt oft mehr Klarheit als jede Schlagzeile.
Und: Verständnis beginnt immer mit Zuhören.









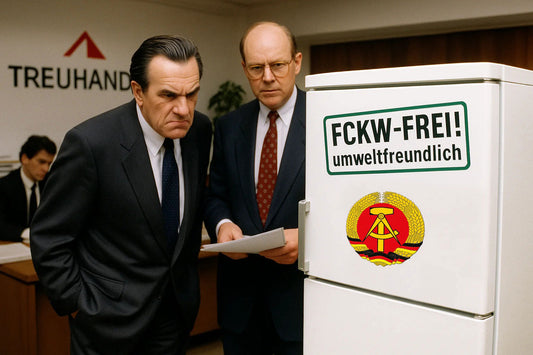
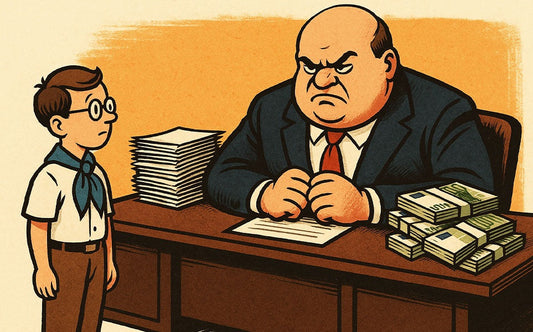





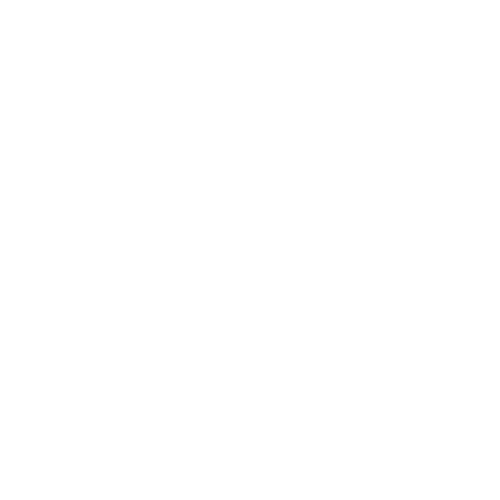



3 Kommentare
Habt ihr einst dafür gekämpft?
Was hat unser Volk nur gelernt,
lief der Banane hinterher,
kämpften für ihre FREIHEIT,
so dachten sie, waren stolz auf den Fall der Mauer,
errichtet wurde eine neue, tiefere, höhere und breitere,
die Spaltung des Volkes, so die Wahrheit,
heute ist das Volk ärmer als zuvor,
denn Fleiß, Ehrlichkeit, Friedens- und Freiheitswillen,
wie der Kämpferwillen und Zuversicht,
sind in der alten Heimat geblieben!
WORIN BESTEHT DER UNTERSCHIED?
Jeder spricht über die Stasi, kennen sie nur aus der Presse,
lebten nicht in der DDR,
nur über die Methoden in der BRD, in der sie leben,
die noch weit aus differenziert, diffamierender
und persönlichkeits-zerstörender realisiert werden,
spricht keiner,
obwohl diese ihr aktuelles Leben beeinflussen,
aktuell jede Wahrheit zur Lüge erklären!
BRÜDER & SCHWESTERN
Brüder und Schwestern, vereinigt euch,
so tönte es, als die Mauer noch stand,
der Ossi vernahm den Ruf und riss diese nieder.
Jetzt rief der Ossi, die Politik ist gegen uns,
wir kennen diese, nur die Masse, die früher riefen,
hörten nicht auf den „blöden“ Ossi,
fühlen sich wohl in ihrer bunten Soße,
so scheint erneut aufgebaut die Mauer!
Die Manipulation der Anschauung!
Ein ganzes Volk vermisste einst die goldgelbe Banane,
bekam nur die kleine, harte und grüne,
die schmeckte keinem, jeder lehnte sie ab,
rümpfte die Nase, nur die Augen wurden gieriger,
beim Anblick der gold-gelblich süßen Frucht,
die aber nach wenigen Tagen,
diese grünen, braunen Flecken bekamen,
oh Schreck, ein brauner Pilz, “Mikrospore”,
zeigte innen einst von grün,
die Wandlung der Banane hin zum braunen Mus,
den NGOs, Grünen und Alt-Parteien.
MEINE WAFFE FÜR DEN FRIEDEN!
Ich schwor den Fahneneid auf meine Heimat,
hielt freiwillig die Waffe in meiner Hand,
aber ich war mir im Herzen bewusst,
niemals ein anderes Land, dessen Volk anzugreifen,
dieses leiden oder ihre Häuser brennen zu lassen.
Zu keiner Zeit hegten wir
einen Angriffskrieg in unseren Gedanken,
ich stand und stehe zum Frieden, zur Diplomatie,
niemals aber zum Krieg.
WORIN BESTEHT DAS ZIEL?
Was für eine goldene Zukunft im “goldenen” Westen
für jeden arbeitenden Menschen,
Mini-Jobber-Steuern, zehn Stunden schuften am Tag,
eine Frage sei erlaubt,
gestellt von denkenden Menschen,
was ist das Ziel, Herr Kanzler,
doch nicht etwa die vom Volk
abgelehnte Bereitschaft für einen Krieg?
EINE VOLKSGNADE HABT IHR NICHT ZU …!
Kriegstreiber, nach 80 Jahren Frieden,
lügt über einen Russland-Angriffskrieg,
nur um eure Rüstungs-Lobby zu hofieren, der Frieden,
unsere Heimat, die Menschen, alles das ist euch egal.
Ihr versteckt euch in Bunkern,
eure schwarzen Seelen interessieren nicht die Leichen,
die Verstümmelten, die vielen Waisen,
die Stille auf den Friedhöfen,
überschwemmt von Tränen.
Nur eine Auswahl, worüber wir vor 89 selten sprachen, unser Leben sicherer war. Wo ist die Unzufriedenheit größer, damals in der DDR oder heute in der BRD? Noch eins möchte ich anführen, ein Problem, was wir damals nicht kannten, uns nicht vorstellen konnten!
UNSERE KINDER LEIDEN!
Ist euch allen bewusst,
was die Kinder und Enkel in unserer Heimat,
gegenwärtig an psychologisch-physischen
Druck wie Schmerz,
täglich in der Schule und in der Freizeit durchleben,
welche Auswirkungen dies auf ihrer Seele hat,
aber was gedenkt die Politik,
endlich wirksam zu ihrem Schutz einzugreifen?
Ein sehr guter Beitrag von euch, ja, realistisch und Tatsache ist nun einmal, es gibt immer zufriedene und unzufriedene Menschen, aber 89 war das ein Überstülpen eines Sackes, so wie im Buch: “Der Deutschland-Clan” von Jürgen Roth, was ich selbst durchleben musste. Euch alles Gute und weiterhin viel Erfolg.
Viele Grüße, Wolfgang W. Ladewig
Sehr gut aufgearbeitet.
Klar war früher in der DDR nicht alles Gold was glänzt aber als Kinder und Jugendliche hatten wir h
noch Respekt vor Erwachsenen und auch untereinander.
Später waren wir bestrebt einen Beruf zu erlernen, wenn auch nicht immer den gewünschten aber es bekam jeder eine Ausbildung.
Ja, es gab auch Kriminalität aber die Täter wurden auf schnellsten Wege verurteilt und die Strafe vollzogen.
Heute werden von Kriminellen nur die Personalien festgestellt und sie werden wieder auf freien Fuß entlassen und verschwinden dann irgendwo in Europa oder sie sind psychisch krank.
Die Kollektivität in den Betrieben und den Hausgemeinschaften war super, so etwas sucht man heute vergebens.
Es gab nicht alles zu kaufen oder nur begrenzt, man konnte nicht überall hin reisen aber mal ehrlich, kann man das heutzutage?
Wer sich an die Gesetze und Regeln gehalten hat, hatte auch ein passabeles Leben in der DDR.
War ja auch viel mehr Polizei und ABV auf der Straße. Und nehmen wir nur mal die Schulen, was ist da heute los, jeder 2. Schüler hat ein Messer dabei, teilweise muss die Polizei patrollieren. Drogenkriminalität gab es nicht. Obdachlosigkeit gab es nicht. Es gab Kleinkriminalität sicher und Schlägereien auf Disko ja, aber im Verhältnis alles viel weniger.