Über den VEB, dessen Innovation mit dafür sorgte, das Ozonloch zu stoppen – und der dafür sterben musste.
🌍 Vorwort: Wenn Fortschritt aus der falschen Richtung kommt
Es war einmal ein Land, das kein Silicon Valley hatte, keine Hedgefonds und keine PR-Agenturen, die aus jedem Schraubenschlüssel eine Weltrevolution machten. "Nur": tausende top ausgebildete Ingenieure, Wissenschaftler und Techniker, die ihr Leben lang für die Gesellschaft forschten, entwickelten und planten – nicht für den Profit großer Konzerne. Mit Letztgenannten hatten sie keinerlei Erfahrung, und das ist vielleicht einer der Gründe, warum so viele von Ihnen nach 1990 gnadenlos über den tisch gezogen wurden.
Wir befinden uns also in einem (nicht ganz so) fernen Land, das alles andere als perfekt war. Aber dessen klügste Köpfe für die Gesellschaft tüftelten (in unserer Kindheit durfte man noch "fürs Volk" sagen).
Und ausgerechnet dort – im tiefsten Erzgebirge, im kleinen Ort Scharfenstein – entstand Anfang der 1990er-Jahre eine technische Innovation, die den Planeten buchstäblich vor dem Ersticken bewahrte: der erste FCKW-freie Kühlschrank der Welt.
Ein Gerät, das weder die Ozonschicht zerfraß, noch schädliche Gase abgab. Eine jener Ideen, die zeigen, was passieren kann, wenn Ingenieure an Lösungen denken – und nicht an Aktienkurse.
Doch im Kapitalismus gilt: Wer aus Überzeugung handelt, ist schon verdächtig. Was im Osten als nüchterne Ingenieursleistung begann, wurde im Westen zur Bedrohung für die Industrie – und endete, wie so viele gute Dinge der DDR, in der Abwicklung durch die Treuhand.
 Abbildungen: Werbung für FORON-Kühlschränke in DR-Eisenbahnen der DDR
Abbildungen: Werbung für FORON-Kühlschränke in DR-Eisenbahnen der DDR
Einschub an dieser Stelle: Es soll ja nach wie vor immer noch unwissende westdeutsche Mitbürger geben, die süffisant sogenannte "DDR-Marken" belächeln. Immerhin jedoch ist zu einigen mittlerweile durchgedrungen, dass ihre Haushalte der 1980er Jahre im Wesentlichen auf DDR-Produkten basierten. Da machen Kühlschränke in Bottrop, Stuttgart oder Hamburg keine Ausnahme: In den 1980er Jahren lieferte das VEB Werk Scharfenstein Kühlschränke an das westdeutsche Versandhaus Quelle, das die Geräte unter der Marke Privileg verkaufte...
⚙️ Die Ausgangslage: Als Kälte noch nach Chemie roch
Ende der 1980er-Jahre war die Sache klar: Der Kühlschrank, das unschuldige Symbol bürgerlichen Wohlstands, war ein Klimakiller. In jedem Gerät zirkulierten Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) – jene unscheinbaren Gase, die in der Stratosphäre die Ozonschicht zerfraßen.
Die Weltgemeinschaft wusste Bescheid. 1987 wurde das Montreal-Protokoll beschlossen, ein globaler Vertrag zur schrittweisen Abschaffung der FCKW. In der Bundesrepublik nickte man verständnisvoll – und setzte trotzdem weiter auf FCKW, oder auf deren kaum bessere Nachfolger, die Fluorkohlenwasserstoffe (FKW).
Umweltfreundlich war das nicht, aber profitabel.
Denn wer die Ersatzstoffe herstellte, saß auf Patenten – und damit auf Geld.
Im Osten dagegen saßen Ingenieure in grauen Kitteln und fragten schlicht:
"Geht das nicht auch anders?"
Bereits 1991 präsentierte die DDR-Firma DKK Scharfenstein als einzige Firma weltweit auf der Haushaltsmesse Domotechnica in Köln ihre Kühlschränke, die nicht mit FCKW, sondern mit pentangeschäumtem Polystyrol isoliert waren. Das weckt das Interesse von Greenpeace, die in dem ostdeutschen Hersteller einen unterstützenswerten Partner entdeckt bei der Entwicklung von FCKW-freien Kühlschränken.

Abbildung: Kühlschrankproduktion im VEB DKK Scharfenstein 1982
🧰 Der Ort: DKK Scharfenstein – ein unscheinbares Weltlabor
Der Betrieb DKK Scharfenstein, später Foron, war kein Hightech-Campus, sondern ein volkseigener Betrieb (VEB) aus dem Erzgebirge. Hier wurde seit Jahrzehnten Kühlschranktechnik gebaut – solide, langlebig, reparabel. DDR-Qualität eben.
Nur zur Erinnerung: Tatsächlich gingen in den 1980er Jahren über 50% aller Wirtschaftsexporte der DDR in die BRD.
Nochmal: Ein Großteil der hochqualitativen Konsumgüter, die in der BRD verkauft wurden, wurde bis 1989 in der DDR produziert. Heimtextilien, Kinderkonfektion, Damenkonfektion, Herrenkonfektion, Spielzeug, Möbel, Elektrogeräte, ja sogar Süßwaren und Lebensmittel: BRD-Haushalte waren (meist ohne es zu wissen) bis zum Dach mit DDR-Produkten gefüllt. Insgesamt bezogen über 6.000 westdeutsche Firmen ihre Produkte aus dem Osten. Darunter auch Salamander, Schiesser, Adidas und Bosch. Auch der Verkaufsschlager von Beiersdorf, die "Nivea Creme", wurde in der DDR hergestellt. Ein Großteil der berühmten Versandkataloge (z.B. "Quelle") setzte sich aus Produkten zusammen, die in der DDR produziert wurden.
Ab 1990 jedoch wurde die nahezu vollständige Zerstörung selbständiger ostdeutscher Betriebe vor allem damit verargumentiert, dass plötzlich deren Qualität für den Markt nicht ausreiche. Ein Märchen, das sich (ebenso wie die angebliche Überschuldung der DDR) bis heute hält.
Doch zurück zur unserer Geschichte, dem Ende des VEB DKK Scharfenstein: Nach der Wende 1990 wurde der Betrieb, wie alle anderen, von der berüchtigten Treuhandanstalt übernommen. Diese hatte den Auftrag, das "volkseigene Vermögen" möglichst schnell zu "privatisieren". Das klang nach wirtschaftlicher Vernunft – war in Wahrheit aber ein gigantischer Ausverkauf.
Tausende Betriebe wurden "bereinigt", also stillgelegt, verkauft oder zerschlagen. Staatlich gefördert wurde hier bekanntermaßen alles an potentieller Konkurrenz für West-Unternehmen eliminiert, der Markt bereinigt. Während der strauchelnden BRD-Wirtschaft ein quasi jungfräulicher Absatzmarkt von knapp 17 Millionen nach buntem Konsum lechzenden Neubürgern serviert wurde.
Was bei der Arbeit der Treuhand zählte, war nicht die Substanz, sondern das Kapitalinteresse. Auch DKK Scharfenstein stand auf der Abschussliste.
Abbildung: Werk des VEB DKK Scharfenstein Anfang der 1970er
🧪 Die Idee: Kohlenwasserstoff statt Chemiekeule
Während westdeutsche Konzerne wie Bosch, Liebherr oder AEG weiter auf FKW setzten, experimentierten die Scharfensteiner Ingenieure mit Propan und Isobutan – ganz gewöhnlichen Kohlenwasserstoffen, ungiftig und mit minimaler Umweltwirkung.
Das war nicht naiv, sondern genial:
Die Substanzen existierten längst, sie waren billig und umweltfreundlich. Nur passten sie nicht ins Geschäftsmodell der westlichen Chemieindustrie.
Unterstützung kam ausgerechnet von Greenpeace, genauer: vom Umweltaktivisten Wolfgang Lohbeck, der die Idee eines natürlichen Kältemittels seit Jahren propagierte – und bei allen westlichen Herstellern abgewiesen worden war.
Nur in Scharfenstein, bei den "Ossis", war man offen für Neues. Ein paar DDR-Ingenieure, ein Labor, ein bisschen Stolz – und der Wille, es der Welt zu zeigen.
Abbildung: Postkarte des VEB DKK Scharfenstein
🔬 1992: Die Geburtsstunde einer leisen Revolution
Im Juli 1992 wurde ein Vertrag zwischen Greenpeace und DKK Scharfenstein geschlossen: Zehn Prototypen eines FCKW-freien Kühlschranks sollten gebaut werden. Greenpeace steuerte 27.000 DM bei – eine kleine, eher symbolische Summe, aber ein mächtiges Signal. Dabei ging es jedoch Greenpeace nicht um den Erhalt des Werkes in Scharfenstein. Greenpeace sieht im bewährten DDR-Betrieb ein Mittel, die eigene Vision zu realisieren und unterstützt deswegen DKK Scharfenstein kurzzeitig.
Währenddessen bereitete die Treuhand bereits die Liquidation des Betriebs vor. Ein Pressebericht über die geplante Schließung wurde veröffentlicht – doch die Scharfensteiner machten unbeirrt weiter: zwei Tage später hielten die Entwickler eine Gegenpressekonferenz: Sie präsentierten ihren "Greenfreeze", den ersten Kühlschrank der Welt, der ohne FCKW und ohne FKW funktionierte.
Die Presse war baff.
Ein kleiner Ostbetrieb, von der Abwicklung bedroht, zeigte den globalen Konzernen, was ökologischer Fortschritt wirklich bedeutet.
🧯 Die Reaktion des Westens: Panik, Spott und Propaganda
Kaum war der Greenfreeze vorgestellt, schlug die westdeutsche Industrie zurück.
Man warnte vor angeblicher Explosionsgefahr, beschwor angebliche Sicherheitsrisiken, sprach von "Feuerfallen in der Küche" und "Todesgefahr durch Propan".
Der westdeutsche Megakonzern AEG ließ sogar eine (Fake-)Studie erstellen, die dem Kühlschrank einen 30 Prozent höheren Stromverbrauch bescheinigte.
Die Botschaft war klar:
Wenn der Osten schon keine maroden Betriebe mehr hat, dann wenigstens gefährliche.
Auch in den Medien klang der Ton vertraut:
Was aus dem Osten kam, war bestenfalls kurios, schlimmstenfalls gefährlich.
Und wenn es funktionierte – dann musste es aus Versehen passiert sein.
Die Realität sah anders aus:
Die Prototypen liefen stabil, sicher und effizient. Der angeblich „höhere Stromverbrauch“ war minimal, die Umweltbilanz überragend.
Doch Fakten stören, wenn Profitinteressen bedroht sind.
Abbildung: in der Produktion
🏭 Die Treuhand schlägt zu
Während Greenpeace und internationale Umweltverbände jubelten, sah die Treuhand nur eines: Einen kleinen, unprofitablen Betrieb im Osten, der dringend "marktgerecht restrukturiert" (also abserviert) werden müsse.
Vielleicht gerade jetzt umso schneller, nach Präsentation der revolutionären Entwicklung des ersten FCKW-freien Kühlschranks der Welt. Unwahrscheinlich, dass den Eliten der BRD-Konzerne mit direkten Drähten zur Treuhandführung, das in die Agenda passte.
Man wollte nun also DKK Scharfenstein schnell verkaufen oder schließen, denn Nachhaltigkeit war kein Kriterium. Ironischerweise lag hier das Paradox der Wendezeit offen: Der Osten hatte mit dem "Greenfreeze" bewiesen, dass ökologischer Fortschritt ohne kapitalistische Gier möglich war – und genau das machte sie verdächtig.
Die "Modernisierung" nach westlichem Vorbild bestand (wie überall auf dem Gebiet der ehemaligen DDR) aus Entlassungen, Schulden, Gutachterhonoraren – und am Ende: Abwicklung.
Abbildung: Präsentation des FCKW-freien Kühlschranks von Foron, 1993
🌪️ Trotz allem: Der Durchbruch
Im Zuge der "Marktöffnung" wurde aus dem VEB DKK Scharfenstein zunächst die DKK Scharfenstein GmbH, dann 1992 – nach einem erzwungenen Eigentümerwechsel – die Foron Hausgeräte GmbH. Foron war bereits zuvor der Markenname für vom Kombinat Haushaltgeräte Karl-Marx-Stadt in der DDR für den Haushalt hergestellte "Weiße-Ware-Erzeugnisse".
Der neue Name klang westlicher, internationaler, sollte Seriosität signalisieren und Investoren anziehen. Doch hinter dem schicken Etikett steckte derselbe Betrieb, dieselben Facharbeiter, dieselben Ingenieure – nur dass jetzt Treuhandverwalter statt Betriebsräte entschieden.
Der traditionsreiche DDR-Betrieb, der einst für Qualität und Ingenieursgeist stand, war nun offiziell "marktfähig" – also abhängig von westlichem Kapital. Aus dem volkseigenen Kollektiv wurde eine GmbH: eine Gesellschaft mit beschränkter Hoffnung.
Trotzdem gelang es den Ingenieuren und der Belegschaft: 1993 brachte Foron den Greenfreeze in Serie. Der Westen lachte – kurz. Dann bestellten plötzlich Läden, Umweltgruppen und sogar westliche Händler das Gerät. Greenpeace bewarb es weltweit, die Idee des Greenfreeze ging um die Welt. Aber: eben nur die Idee. Absahnen taten andere.
Bereits 1992 endete die Unterstützung durch Greenpeace: Die Umweltorganisation hatte ihr erklärtes Ziel dank der Ostdeutschen erreicht. Der funktionsfähige, FCKW-freie Kühlschrank war in der Welt.
Was folgte, war durchaus im Sinn von Greenpeace (uns sicher auch der Umwelt), jedoch weniger im Interesse des ostdeutschen Werkes in Scharfenstein: Bosch, Siemens, Liebherr und Miele bedienten sich an der Blaupause aus dem Osten.
🏚️ Warum Foron scheitern musste
Dass Foron trotz weltweiter Aufmerksamkeit und technologischem Vorsprung unterging, war kein Zufall – sondern System.
Der Greenfreeze war zu gut, um in einem Markt überleben zu können, der vom Ersatzbedarf lebt. Das Gerät war langlebig, effizient, billig im Unterhalt – und damit genau das, was die marktdominierenden Konzerne nicht wollen: ein Produkt, das sich nicht wiederholt verkaufen lässt.
Hinzu kam die ökonomische Realität der frühen 1990er:
- Keine westdeutsche Bank wollte Foron Kredite geben.
- Händlerketten nahmen das Gerät nicht ins Sortiment – aus Angst, ihre Beziehungen zu den großen westlichen Marken zu gefährden.
- Politische Unterstützung? Fehlanzeige. Umweltminister Töpfer lobte das Prinzip, tat aber nichts, um die Produktion im Osten zu sichern.
- Während Greenpeace Foron als "Weltretter aus dem Osten" feierte, verhungerte der Betrieb finanziell.
-
Die Produktion blieb klein, die Aufträge unregelmäßig, die Kosten stiegen.
Aufgrund einer Vereinbarung mit Greenpeace, hatten die (naiven?) Ingenieure in Scharfenstein kein Patent auf ihre Innovation angemeldet. Und nun kam, was kommen musste: Kurze Zeit später später übernahmen westdeutsche Hersteller das Prinzip (man könnte auch vorsichtig sagen: "stahlen es") – mit Patenten, Werbung, riesigem Kapital und Vertriebsnetz. Foron stand daneben, als die eigene Erfindung millionenfach verkauft wurde – nur eben ohne Foron.
So wurde aus dem Pionierbetrieb von Scharfenstein das, was die Treuhand immer wollte: Geschichte.
Schon nach zwei Jahren war der Siegeszug perfekt:
Rund 100 Millionen Kühlschränke weltweit nutzten das umweltfreundliche Prinzip aus dem Osten. Und heute – drei Jahrzehnte später – ist der FCKW-freie Kühlschrank globaler Standard.
Die Idee aus Scharfenstein wurde zur Norm – doch das Werk selbst überlebte nicht.
2001 war Foron Geschichte. 5.000 Werktätige wurden entlassen.
🧊 Zwischenfazit: Der Osten war bei vielem früher, der Westen war lauter
Der Greenfreeze war kein Zufall. Er war das Ergebnis einer Bildungstradition in der DDR, in der Ingenieurwesen, Umweltbewusstsein und gesellschaftliche Verantwortung nicht getrennt gedacht wurden. In der DDR galt: Technik sollte dem Menschen dienen – nicht dem Markt.
Das bedeutete keine Romantik, sondern Rationalität. Die DDR war (trotz eigener Umweltprobleme, die jedoch im Westen Deutschland ähnlich waren) in vielen Umweltbereichen weiter als die BRD:
- in den 1980er-Jahren bereits FCKW-freie Spraydosen,
- Forschung zu geschlossenen Stoffkreisläufen,
- systematische Abfallverwertung in Kombinaten,
-
das legendäre SERO-System – das fortschrittlichste Recyclingnetz der Welt, Jahrzehnte bevor der Westen "Recycling" überhaupt buchstabieren konnte.
 Abbildung: "Ham'se nicht noch Altpapier?" Kein Kind des Ostens, kein Jungpionier, kein Thälman-Pionier, der sich nicht sein Taschengeld mit eigenem Fleiß massiv mit der Sammlung von Altstoffen für die SERO aufbesserte. Dabei gingen viele Spenden nicht nur nach Nicaragua, Mosambik oder Vietnam. Ein großer Teil blieb auch übrig für das eigene Mokka-Eis oder wurde schlicht gespart für das nächste Fahrrad.
Abbildung: "Ham'se nicht noch Altpapier?" Kein Kind des Ostens, kein Jungpionier, kein Thälman-Pionier, der sich nicht sein Taschengeld mit eigenem Fleiß massiv mit der Sammlung von Altstoffen für die SERO aufbesserte. Dabei gingen viele Spenden nicht nur nach Nicaragua, Mosambik oder Vietnam. Ein großer Teil blieb auch übrig für das eigene Mokka-Eis oder wurde schlicht gespart für das nächste Fahrrad.
Über 90 % aller Glasflaschen wurden wiederverwendet, Kinder brachten Altpapier und Altglas zur Annahme, und Rohstoffe blieben im Kreislauf. Was im Westen später als "Kreislaufwirtschaft" teuer neu erfunden wurde, war im Osten längst Alltag – organisiert, effizient und sozial eingebettet.
Doch diese Entwicklungen wurden nach 1990 nicht fortgeführt, sondern vernichtet oder privatisiert. Das, was man heute "Green Tech" oder "Nachhaltigkeit" nennt, wurde im Osten oft schon praktiziert – nur eben ohne Marketing- und Investorensprech.
💸 Ironie der Geschichte
Der Osten hatte die Welt gerettet – aber nichts davon. Keine Patente, keine Rendite, keine Schlagzeilen im Wirtschaftsteil. Nur der stille Stolz einiger Ingenieure, die wussten, dass sie recht gehabt hatten.
Die westdeutschen Konzerne zogen nach, rüsteten ihre Produktion um und vermarkteten das Konzept als "eigenes Umweltbewusstsein". In Wirklichkeit hatten sie (einmal mehr) nur kopiert, was der Osten erfunden hatte.
Während Foron unterging, sicherten sich westliche Hersteller und Chemiekonzerne die Zukunft. Sie meldeten Patente auf Kühlkreisläufe, Ventile und Gasgemische an, die auf der DDR-Grundidee basierten – diesmal natürlich mit Hochglanzbroschüre und TÜV-Zertifikat.
Westdeutsche Medien nannten es "deutsche Ingenieurskunst". Niemand erwähnte Scharfenstein, niemand sprach von DKK oder Foron.
So funktioniert Kapitalismus:
Ideen werden nicht nach ihrem Nutzen, sondern nach ihrem Besitz bewertet.
Und Besitz hat, wer Anwälte und Banken hat – nicht wer die Idee hatte.
Der Fall Foron zeigt den fundamentalen Gegensatz, der uns bereits in DDR-Schulbüchern beigebracht wurde, und der nun, Jahrzehnte später durch Praxiserfahrung bestätigt wurde:
Sozialistische Technologie wollte die Welt verbessern.
Kapitalistische Technologie will sie besitzen.




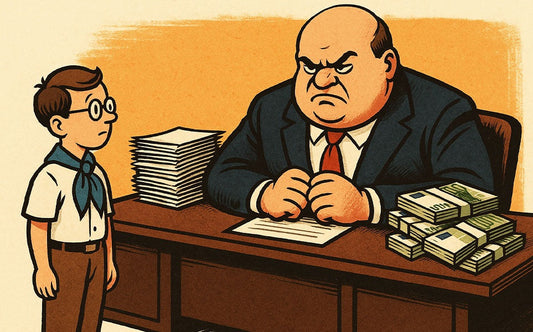




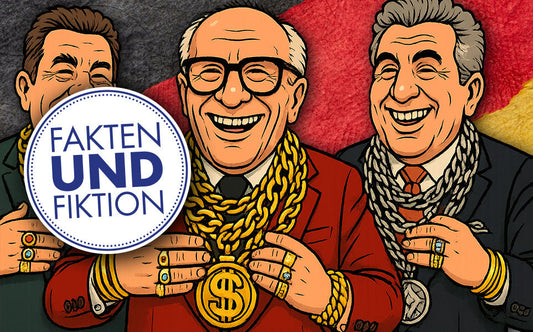






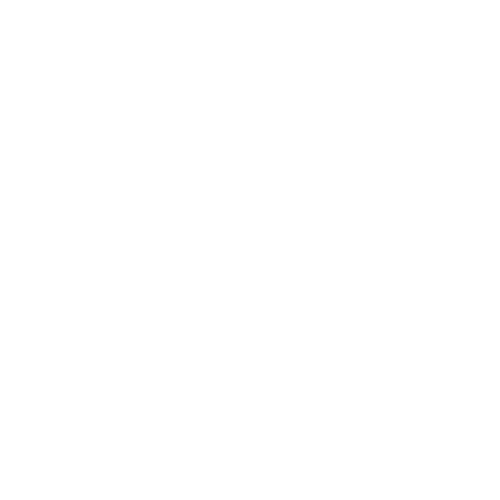



2 Kommentare
Zu spät. Mehr als 35 Jahre zu spät. Und nur ein Betrieb von vielen. Warum haben wir das mit uns machen lassen? Und welche Lehren haben wir für die heutige Zeit daraus gezogen? Darüber sollten wir alle nachdenken. Und nicht nur wir Ossis!
Danke für diesen Bericht! Ja so war es. Viele Produkte der DDR wurden als Billigware in der BRD verramscht. Unsere Produkte waren langlebig und reparaturfreundlich. Unser Mixer RG28 läuft nach 45 Jahren immer noch.