von Markus Gelau
🏗️ Ein Haus, das "Öffentlichkeit" ernst meinte
Der Palast der Republik war kein prestigeorientierter Staatsbau, sondern die gebaute Umsetzung einer Idee: Die Mitte der Hauptstadt gehört dem Volk.
Inmitten von Berlin entstand in der DDR ein Gebäude, das nicht Repräsentation von oben, sondern Zugehörigkeit von unten organisierte. Zwischen 1973 und 1976 errichtet, maß der Palast 180 × 85 Meter bei 32 Metern Höhe. Über 100.000 Quadratmeter nutzbare Fläche, getragen von 29.000 Tonnen Stahl. Doch seine Bedeutung lag nicht in seiner Größe, sondern in seiner Funktion:
- Hier sollte die Gesellschaft sich selbst begegnen.
- In nur vierzehn Jahren kamen über siebzig Millionen Besucher.
- Mehr als 21.000 Veranstaltungen, von Tanzabenden über Gewerkschaftsforen bis zu internationalen Konzerten, fanden statt.
- Nur unter fünf Prozent davon waren politisch-staatliche Termine.

Abbildung: Musikveranstaltung für die Jugend Ende der 1970er
Das nach der sogenannten "Wende" politisch und medial verbreitete Bild vom "SED-Repräsentationsbau" ist nicht nur schlicht falsch – es ist bewusst konstruiert. Der "Palast" war zu keinem Zeitpunkt ein Monument ideologischer SED-Kultur (wie man es ihm aus Richtung Westdeutschland in den 1990ern vorwarf). Er war kein Elitenbau, sondern ein öffentlicher Raum für ganz normale Menschen, für die Bevölkerung der DDR. Das Herzstück des gesellschaftlichen Lebens ihrer Hauptstadt, wo Kultur und Alltag zusammenkamen, ein offener Raum der Teilhabe für alle – das Gegenteil eines abgeschotteten Regierungspalasts.
Abbildung: Der Palast aus einer seltenen Perspektive, Ende der 1980er
🎭 Ein Volkshaus statt eines Palastes
Der Palast der Republik entstand statt des preußischen Stadtschlosses, dessen Ruine nach dem Krieg stehen geblieben war – ein Symbol einer Ordnung, in der Wenige herrschten und Viele dienten.
Die DDR entschied sich bewusst dagegen, diese Ordnung zu restaurieren. Sie entschied sich gegen Standesarchitektur und feudale Mitte. Und so wurde statt eines Herrschaftssitzes ein Haus für alle gebaut. Nicht als Geste. Sondern als staatliche Haltung:
- Kultur ist keine Dekoration.
- Kultur ist Bestandteil sozialer Gleichheit.
- Gemeinsame Räume schaffen Gemeinschaft, nicht Markt.
In der BRD wurde Kultur im selben Zeitraum zunehmend zum sozialen Filter: Einkommen, Haltung, Sprache, Auftreten entschieden über Zugang. Die BRD organisierte im Verlauf der 1960er und 1970er Jahre ihre Kulturinstitutionen zunehmend marktförmig, kulturelle Teilhabe dort immer stärker von sozialen Voraussetzungen abhängig. Theater, Konzerthäuser, Museen – sie blieben (wie bereits vor 1949) Orte, an denen sich ausschließlich Bildungsbürger und Mittelstand selbst begegneten.
Eine "Kultur", die bis heute vorherrscht:
- Wann schon besuchen Arbeiter in der BRD Theater?
- Wann haben Bürgergeldempfänger Zugang zu wissenschaftlichen Vorträgen?
- Wann sitzt die Pflegekraft im Opernhaus?
- Wann kann ein Azubi einfach so in die Philharmonie gehen?
- Wann betritt ein KFZ-Schlosser einen Kunsttempel?
Man braucht das richtige Vokabular, die richtige Kleidung, die richtige Art zu sprechen und sich zu bewegen. Und vor allem: Man musste es bezahlen können.
Kultur ist im Westen nie entkoppelt worden von Geld und Herkunft.
In der DDR war die kulturpolitische Zielsetzung diametral entgegengesetzt: Kultur sollte nicht trennen, sondern verbinden. Kulturelle Bildung war Teil des Schulwesens, nicht Privatprojekt einzelner (Gesellschafts-)Klassen:
- Eintrittspreise waren eher symbolisch, niedrig und einheitlich.
- Theater, Literatur, Musik, bildende Kunst waren Teil der Grundversorgung.
Menschen (Arbeiter, Bauern) sollten lernen, sich in solchen Räumen selbstverständlich zu bewegen. Und: sich darin wohlzufühlen. - Kultur sollte kein Trennmittel sein, sondern ein Gemeingut.
Darum war der Palast der Republik ein Volkshaus – nicht als Parole, sondern als Realität. Man ging hinein, ohne Schwelle, ohne Prüfung, ohne Rolle. Es gab keine "richtige" Art, sich zu verhalten. Das Dasein selbst war ausreichend.
In den "Grundlagen für die Projektierung" vom Ministerium für Bauwesen der DDR (1973) steht wörtlich:
"Ziel ist die Errichtung eines multifunktionalen Volkshauses für Kultur, Begegnung und gesellschaftliches Leben."
Die Bezeichnung "Volkshaus" war also nicht nachträgliche Erzählung, sondern bereits vor Beginn des Baus formaler Planungsbegriff. (Quelle: BArch, DR 1/23133 „Projektunterlagen Palast der Republik“, Bl. 4–6.)

Abbildung: Typischer Anblick: Der Palast im Sommer, Mitte der 1980er
🌆 Öffentlichkeit als Alltag – nicht als Ausnahme
Wer den Palast betrat, betrat eine eigene offene, helle und grandiose Stadt unter einem Dach. Es gab keine Kontrollen, keine Security, keine Schranken, keine Eintrittsbarrieren, keine Eintrittskarten. Man war einfach da – und das war ausreichend. Für uns Kinder der DDR war und ist der erste Besuch bis heute unvergesslich. Und selbst Berliner, die öfter die Möglichkeit hatten, den "Palast" zu besuchen, schwärmen bis heute. Der Palast war das größte zusammenhängende Gastronomiesystem der DDR (auch der BRD) – größer als jedes Kaufhaus, jeder Bahnhof, jedes Kulturhaus. 13 gastronomische Betriebe mit mehr als 2.800 Sitzplätzen machten ihn zum größten offenen Treffpunkt Deutschlands. Der Palast bot allen Menschen:
- Cafés, Restaurants, Bars
- Großsaal für Konzerte und Kongresse
- Theater im Palast
- Lesungen, Debatten, wissenschaftliche Vorträge
- Diskothek, Bowling, Kinder- und Jugendräume
- Buchhandlungen & offene Aufenthaltsbereiche
Aber entscheidender als das Programm war das Alltagsgefühl:
Im Palast der Republik war jeden Tag "Tag der offenen Tür".
Hier war Öffentlichkeit nicht Veranstaltung, sondern Zustand. Man musste nichts "konsumieren", um anwesend zu sein. Man musste keine Rolle spielen, keine Zugehörigkeit beweisen. Der Palast war ein Raum, in dem Menschen sich als Teil der Gesellschaft erlebten – nicht als Kunden. Das ist heute fast unvorstellbar.
Und genau das macht verständlich, warum dieser Raum später vernichtet wurde.

Abbildung: Die Kinderkarte des Palastes (1980er Jahre)

Abbildung: Eine (gehobene und damit teure) Speisekarte des "Palastballs" von November 1985. Die Preisstufe "S" war die "Sonderpreisstufe / Sonderbewirtung" und damit die teuerste und höchste Kategorie des Hauses.
Die Preisstufen der DDR-Gastronomien waren überall einheitlich und transparent geregelt, so auch im Palast der Republik:
Preisstufe A stand für die volkstümlichen Angebote, wie etwa die Bierbar "Zum Fichtenholz" und andere Schankbereiche. Hier gab es sehr günstige Preise, einfache Snacks, Bier und Soljanka – ein Ort für den schnellen, unprätentiösen Besuch. Eine Stufe darüber lag Preisstufe B, die man in Bereichen wie dem Café "Spreeblick" oder dem Selbstbedienungsrestaurant fand. Hier galten mittlere Standardpreise; angeboten wurden Tagesgerichte, Kuchen und einfache Desserts – ein klassischer Treffpunkt für Familien, Theaterbesucher und Stadtpublikum. Die Preisstufe C war bereits gehoben. Dazu gehörten zum Beispiel das Terrassenrestaurant und Teile der Abendgastronomie. In diesen Bereichen gab es Bedienung am Tisch, eine größere Auswahl an Speisen und Getränken sowie besser gedeckte Tische. Diese Räume wurden gern zu besonderen Anlässen genutzt. Ganz oben stand Preisstufe D, die repräsentativen Bereiche, etwa das Restaurant im 5. Obergeschoss, in dem auch Staatsgäste und Delegationen bewirtet wurden.

Abbildung: Foyer des Palasts
🌍 Ein Ort, an dem die Welt zu Gast war
Der Palast der Republik war kein geschlossenes Kultursystem. Er war ein Durchgangsraum zur Welt, ein Ort, an dem internationale Künstler, Wissenschaftler und Bewegungen auf ein ostdeutsches Publikum trafen – ohne VIP-Räume, ohne Distanz, ohne Eintrittsbarrieren, die abschrecken oder aussortieren.
Hier traten Künstler auf, die anderswo in Europa entweder nicht eingeladen oder nur für eine kaufkräftige Schicht erreichbar waren. Einer der eindrucksvollsten Gäste: Harry Belafonte.

Abbildung: Friedenskonzert am 25. Oktober 1983 im Palast der Republik (u.a.) mit Harry Belafonte
Belafonte war nicht nur Musiker, sondern eine Schlüsselperson der globalen Bürgerrechtsbewegung: Vertrauter von Martin Luther King, Aktivist gegen Apartheid, Unterstützer antikolonialer Befreiungsbewegungen. In der BRD trat er in den 1970ern und 1980ern vor allem in abgezirkelten Konzertformaten auf — teuer, distanziert, kuratiert für ein bürgerliches Bildungs- und Medienpublikum.
Im Palast der Republik dagegen stand Belafonte auf einer Bühne für alle. Seine Konzerte waren öffentlich erschwinglich. Arbeiter, Schüler, Pflegekräfte, Studierende und Rentner saßen nebeneinander, nicht getrennt nach Preisgruppe oder gesellschaftlicher Rolle.
Und er war nicht der Einzige:
- Puhdys (prägende DDR-Rockband, identitätsstiftend)
- Karat (Art-Rock aus der DDR, „Über sieben Brücken“)
- Silly (New-Wave/Art-Pop, politisch codiert)
- City ("Am Fenster" – urbaner Klang der DDR-Jugend)
- Holger Biege (poetischer Pop-Chanson der DDR)
- Veronika Fischer (eine der markantesten Stimmen der 1970er)
- Gisela May (weltweit gefeierte Brecht-Interpretin)
- Eva-Maria Hagen (Theater, Chanson, kulturelles Rückgrat einer Epoche)
- Nina Hagen (frühe Phase in der DDR – zwischen Punk, Theater, Chanson)
- Manfred Krug (Jazz-Chanson & populäre DDR-Schauspielikone)
- Kurt Masur & Gewandhausorchester Leipzig (klassische Spitzenkultur aus dem Osten)
- Staatskapelle Berlin (europäische Klangtradition, öffentlich zugänglich)
- Rundfunkchor Leipzig (Chormusik auf Weltniveau, kein Elitenraum)
- Harry Belafonte (USA) (Bürgerrechtsbewegung, Anti-Apartheid, Solidarität)
- Miriam Makeba (Südafrika) (im Exil; Stimme Afrikas gegen Rassentrennung)
- Mercedes Sosa (Argentinien) (Stimme der lateinamerikanischen Volksbewegungen)
- Mikis Theodorakis (Griechenland) (Widerstand gegen Militärdiktatur)
- Gilbert Bécaud (Frankreich) (Chanson – ohne bürgerlichen Zugangscode)
- Dean Reed (USA → DDR) (bewusster Bruch mit US-Imperialkultur)
- Udo Lindenberg (BRD) (kam gegen westliche Staatsräson in den Osten)
- Peter Maffay (trat bereits vor seiner BRD-Popkarriere öffentlich auf)
- Katja Ebstein (beidseitig aktiv, linke kulturelle Haltung)
- Inti-Illimani (Chile) (im Exil nach Pinochet, Klang der Unidad Popular)
- Quilapayún (Chile) (antifaschistische Exil-Kultur in musikalischer Form)
- Sheila B. Devotion (Frankreich) (Pop ohne VIP-Zugang)
- Boney M. (DDR-Fernsehgastspiel für ein Massen-Publikum, nicht Elite-Ticket)
- Staatsensembles aus Kuba, Vietnam, Angola und Mosambik (nicht „Folklore“, sondern kulturelle Diplomatie unter Befreiungsstaaten)
- Sowjetisches Akademie-Kammerorchester (kultureller Austausch auf Augenhöhe, keine Überordnung westlicher Kulturformen)
- Gastkünstler aus Indien und der Mongolei (Teil der blockfreien und sozialistischen Kulturbeziehungen, nicht exotisierende Vorführung)
- Urania-Vortragsreihen (Erdbeobachtung, Kosmos, Medizin – Wissenschaft als öffentliches Wissen, nicht akademische Eliteveranstaltung)
- Literaturwochen mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern aus Afrika, Lateinamerika und Asien (Dekoloniale Perspektiven nicht als „Gast“, sondern als gleichwertige Weltstimmen)
Während westliche Kulturinstitutionen im selben Zeitraum strenger sortierten – wer spricht für wen, wer darf für wen auftreten, wer gehört wohin – setzte der Palast auf Solidarität als Normalzustand, nicht als Event.

Abbildung: modern und fast futuristisch, die Theaterbar im Palast
☕ Kultur als Menschenrecht – nicht als Eintrittsklasse
Die Preise im Palast der Republik waren bewusst niedrig gehalten.
- Ein Bier kostete eine Mark,
- eine Tasse Kaffee fünfzig Pfennig,
- Ein vollwertiges Mittagessen in den Großgaststätten zwei bis vier Mark,
- ein Stück Kuchen siebzig Pfennig
Das war nicht "billig" im Sinne von Ramsch oder Sparprodukt, sondern Teil eines gesellschaftlichen Konzepts. Essen, Kultur und Aufenthalt waren öffentliche Infrastruktur – kein Geschäftsmodell, keine betriebswirtschaftliche Profitstelle, kein sozialer Filter. Der Palast war so gestaltet, dass Menschen sich dort ohne Kaufzwang aufhalten konnten. Man musste nichts bestellen, um zu bleiben. Die Preise waren kein Service. Sie waren Politik.
Abbildung: Original-Kaffeekarte aus einem der Palastrestaurants (1980er)
Die gastronomischen Preise im Palast lagen höher als im Rest der DDR, waren jedoch in der Summe immer noch lächerlich niedrig im Vergleich zu heute. Preise wie 60 Pfennig für ein Stück Obstkuchen waren kein Service, sondern gesellschaftliches Versprechen:
- Kultur soll verbinden, nicht auswählen.
- Öffentlichkeit soll zugänglich sein, nicht exklusiv.
- Gemeinschaft darf nicht käuflich sein.
Während die BRD Kultur zunehmend über Kaufkraft regulierte, entkoppelte die DDR Kultur von Einkommen. Der Palast war damit nicht nur ein Gebäude, sondern ein sozialer Gegenentwurf. Er zeigte, dass eine Stadtmitte nicht privatisiert sein muss.
Und genau dieser Nachweis war gefährlich.
Abbildung: Berlin, Hauptstadt der DDR, 1984
☣️ Der Asbest-Vorwand – und die tatsächlichen Interessen
Also brauchte man ein scheinbar objektives Argument, das niemand bestreiten konnte: Asbest.
1990 wurde der Palast plötzlich geschlossen. Begründung: Asbestbelastung. Doch die Asbestfasern im Palast waren gebunden – und damit stabil, ungefährlich, nicht freigesetzt.
Aussagekräftig sind 2 historische Asbest-Messungen von 1990, die wir hier gegenüberstellen
Palast-Innenluft: < 500 Fasern/m³
Berliner Straßenverkehr: bis zu 7.000 Fasern/m³
Das bedeutet: Die Luft draußen, auf den Straßen Berlins war 1990 vierzehn mal kontaminierter als die Luft im Palast.
Und das stand in den Akten, war offiziell, belegt und für jeden Interessierten (auch aus Politik und Presse) zu lesen. Gleichzeitig existier(t)en in Berlin weiterhin Gebäude mit weit höherer Asbestbelastung als die im Palast der Republik:
- Philharmonie
- TU Berlin
- Charité-Bauten
- ZDF-Gebäude
- ICC (Sanierung geschätzt: > 2,1 Mrd. €)
Asbestbelastung: Das traf 1990 auf über 5.000 öffentliche Gebäude in Berlin zu. Die ebenfalls merkwürdigen Umstände der Schließung des Palasts sind aussagekräftig. Eine Asbestuntersuchung fand erst im Dezember 1990 statt: 3 Monate nach der Schließung des Palasts. Das Gutachten erstellte: eine westdeutsche Firma.
Die Messprotokolle dieses Gutachtens sind (laut etablierten Chronisten wie Rudolf Denner) aus dem Bauamt Berlin verschwunden und nicht mehr auffindbar. Und in dem im August 1990 unterzeichneten und im September von beiden deutschen Parlamenten, Volkskammer und Bundestag, verabschiedeten Einigungsvertrag war fixiert:
"Die kulturelle Substanz in dem in Artikel 3 genannten Gebiet (DDR) darf keinen Schaden nehmen."
Der Unterschied zwischen den oben genannten, ca. 5000 Asbest-belasteten Gebäuden Berlins und des Palasts war nicht das Material. Der Unterschied war die Bedeutung.
Aufschluss über die Absurdität des Abrisses geben auch folgende Kostenvergleiche (der Transparenz wegen umgerechnet in Euro):
- Die Asbest-Sanierung des Palasts hätte laut Gutachten gekostet: 125–180 Mio. €.
- Der Abriss des Palasts kostete: 120 Mio. €.
- Der Neubau des preußischen Schlosses mit Humboldt Forum kostete: über 677 Mio. €.
- Allein der Betrieb des neu erbauten Schlosses verschlingt jährlich: ca. 50 Mio. €.
Der Abriss des "Palasts der Republik" war nicht technisch, sondern ideologisch begründet. Asbest war der Vorwand. Der Palast selbst war das Problem.
Abbildung: Das Berlin unserer Kindheit: bunt, aufregend, sicher
Abbildung: Berlin war in der DDR nicht nur Hauptstadt, sondern Schaufenster und Versprechen zugleich. Die Stadt zog Menschen aus allen Teilen des Landes an – als Symbol für Fortschritt, Kultur und Urbanität, ohne die Kälte westlicher Metropolen. Berlin war modern, aufgeschlossen, lebendig – und dennoch menschlich geblieben. Es gab viel zu entdecken: Ausstellungen, Theater, Film, Straßenkunst, Architektur, Alltag. Die Stadt atmete Internationalität, ohne dabei ihre Ruhe zu verlieren.
In Teilen Berlins waren Restaurierungen nötig, das ist unbestreitbar. Diese begannen jedoch bereits Anfang der 1980er (z.B. mit dem Nikolaiviertel). Vorher lag die Priorität der DDR-Führung auf dem Bau und der Sicherstellung von Wohnraum für Familien.
Und: Berlin war sicher. Frauen konnten nachts allein nach Hause gehen, Kinder spielten in den Höfen, alte Menschen saßen auf Bänken – ohne Angst. Das Leben fand gemeinschaftlich draußen statt. Es gab keine "No-Go-Areas", keine Ghettoisierung, keine abgeschotteten Bezirke nach Einkommen oder Herkunft.
🧱 Die systematische Entsorgung der DDR-Öffentlichkeit
Der Abriss des Palastes stand in einer Reihe mit weiteren Eingriffen in das kollektive Gedächtnis Ost-Berlins:
- Ahornblatt → 1997 für Investoreninteresse abgerissen
- Freiflächen am Fernsehturm → geplante Parzellierung & Kommerzialisierung
- Haus der Statistik → jahrzehntelange Entwertung, spätere Privatisierungslogik
Und stellvertretend: das SEZ, das "Sport- und Erholungszentrum" in der Landsberger Allee (Eröffnung 1981).
🏗️ Wird DDR-Erbe radikal ausradiert? Auch das Berliner SEZ wird nun abgerissen – und mit ihm ein weiteres Stück unserer Erinnerung.
Wer in Berlin aufgewachsen ist, kennt diesen Ort: das Sport- und Erholungszentrum an der Landsberger Allee, kurz "SEZ". Ein Bau wie aus einer besseren Zukunft – gläsern, großzügig, sozial gedacht. Auch hier war jeder willkommen: vom Rentner über die Schülerin bis zum Ingenieur aus dem Werk. Keine VIP-Tickets, kein Premium-Tarif, keine Werbung. Nur Sport, Bewegung, Begegnung – und das gute Gefühl, dass ein Staat für seine Menschen baut, nicht für Investoren.
Das SEZ war kein Freizeitpark, es war ein Volksgut. Schwimmen, Tischtennis, Kegeln, Volleyball, Sauna – alles unter einem Dach. Wo heute Fitnessstudios und Spa-Ketten ihre Preise nach Einkommen staffeln, zahlte man im SEZ ein paar Mark und war Teil eines gemeinsamen Lebensgefühls. Es war Architektur mit Herz: funktional, offen, hell, für alle.
Ein multifunktionaler Gebäudekomplex für Sport und Unterhaltung in Berlin-Friedrichshain, der zur Eröffnung 1981 in seiner Größe weltweit (!) einzigartig war.
Abbildung: Das legendäre SEZ in Berlin (Ende der 1980er)
Es vereinte ein riesiges Schwimm- und Spaßbad mit Sporthallen, Eislaufbahn, Fitnessstudios, Kindersportgarten, medizinischen Praxen, Ballettsälen, Bowling, Friseuren, Saunen, zehn (!) verschiedenen Gastronomien u. v. m.. Wer durch die hellen Hallen ging, roch Chlor, hörte Lachen, fühlte Leben. Kinder lernten schwimmen, Rentner machten Wassergymnastik, Jugendliche spielten Tischtennis, Familien verbrachten Sonntage zwischen Bad, Sauna und Bowlingbahn. Kein "All Inclusive", sondern "Alle gehören dazu".
Das SEZ war ein Monument der Idee vom Gemeinsamen. Hier zeigte sich, was die DDR wollte: nicht Prestige, sondern Teilhabe. Kein Glas-Stahl-Palast für Geschäftsleute, sondern ein Volkszentrum – gebaut mit Stolz, geplant mit Sinn.
Nach der Wende kam die große Kälte: Aus dem Volkseigentum wurde Beute, wie überall. Erst verschleudert, dann vernachlässigt. Aus einem Haus der Bewegung wurde ein Symbol des Stillstands. Für 1 Euro kaufte im Jahr 2003 ein Investor das 4,5 Hektar große Areal am Rande des Volksparks Friedrichshain. Berlin wollte das ehemals so grandiose Spaßbad der DDR loswerden.
Nachdem man das Wunderwerk – manch einer sagt: bewusst – Jahrzehnte hat vergammeln lassen, verkündete die Stadt Berlin im September 2025, das SEZ sei:
"wesentlich durch die Erlebniswelt inklusive Spaßbad geprägt gewesen". Dieser Teil sei jedoch "durch Abrisse, Einbauten, Bauschäden und Vandalismus geschädigt und verloren".
Ergebnis: Das SEZ wurde nicht unter Denkmalschutz gestellt – der Weg für den Abriss ist frei. An gleicher Stelle werden Investoren und Konzerne mit hunderten neuen Wohnungen viel Geld verdienen.
Das kommende Ende des SEZ ist – ähnlich wie die Tragödie um den Palast der Republik – mehr als ein Abriss. Es ist das langsames Verlöschen eines Gedächtnisses: Unseres Gedächtnisses daran, dass man Dinge auch anders denken konnte – solidarisch, gemeinschaftlich, menschlich, nicht profitorientiert.
Es ging darum, Räume kollektiver DDR-Erfahrung zu entfernen. Nicht, weil sie schlecht waren. Sondern weil sie zeigten, dass eine andere Stadt, vielleicht auch eine andere Gesellschaft, möglich waren.

Abbildung: Der Palast und der Dom, 1986
👑 Die Rückkehr der alten Mitte
"Vorwärts immer, rückwärts nimmer" – dieser Satz, der einst wie ein Mantra durch die DDR hallte, wirkt heute zynisch. Denn was nach 1990 in Berlin geschah, war das Gegenteil: kein Fortschritt, sondern die architektonische Rückabwicklung einer Republik. Aus der Hauptstadt eines sozialistischen Staates wurde wieder das Schaufenster eines Feudalsystems. Vorwärts? Nur beim Rückbau der Geschichte.
1992 beschloss der Berliner Senat (Große Koalition CDU/SPD unter Eberhard Diepgen), den Palast der Republik zu entfernen und das Stadtschloss wieder aufzubauen. In den damaligen Beschlussbegründungen ist ausdrücklich von der:
"Beseitigung der sozialistischen Bauzeugnisse im historischen Zentrum“ die Rede.
(Quelle: Abgeordnetenhaus von Berlin, 12. Wahlperiode Drucksache 12/3239, eingebracht vom Senat, 15.10.1992)
Wolfgang Thierse (SPD) nennt es 1992 im Abgeordnetenhaus Berlin wörtlich:
"...eine symbolische Tilgung der DDR aus der Stadtmitte."
(Quelle: Plenarsaal-Protokoll, Abgeordnetenhaus Berlin, 1992)
CDU-Stadtentwicklungssprecher Hans Helmcke sagte wörtlich:
"Der Palast ist ein Symbol des SED-Staates. Sein Verbleib wäre ein Monument der Unfreiheit im Herzen der Stadt."
(Quelle: Abgeordnetenhaus Berlin, Plenarprotokoll 12/25, 15.10.1992
Debatte zum Schlossplatz-Beschluss)
Das heutige Schloss ist kein historischer Wiederaufbau. Es ist eine Betonhülle mit barocker Kostümfassade, finanziert von Netzwerken, die in der Rückkehr sozialer Distanz ihre kulturelle Selbstversicherung finden. Das Humboldt Forum ist keine Öffnung, sondern Restauration.

Abbildung: die "große Halle" des Palasts, das zentrale Herzstück des Gebäudes, ein gewaltiger, lichtdurchfluteter Raum, der je nach Bestuhlung rund fünftausend Menschen fasste. Die Akustik war hochwertig und flexibel, die Bühnentechnik auf dem Stand ihrer Zeit, ausgelegt für Live-Spektakel ebenso wie für Fernsehübertragungen. Das Gebäude selbst, mit seinen warmen Bronzetönen und den tausenden Glaskugelleuchten, verlieh dem Saal einen festlichen, fast sanft-glühenden Charakter. Im Großen Saal fanden neben offiziellen Sitzungen der Volkskammer auch Rock- und Jazzkonzerte statt, was ihm etwas Ungewöhnliches gab: Er war gleichermaßen Staatsraum und Kulturbühne, offizieller Rahmen und ein Ort der Freude.
🟧 Wer entschied eigentlich über den Abriss?
Der Abriss des Palastes der Republik war keine Berliner Einzelentscheidung, sondern ein Beschluss auf Bundesebene. Am 19. Januar 2006 stimmte der Deutsche Bundestag mehrheitlich dafür, das Gebäude vollständig abzureißen und an seiner Stelle das rekonstruierte Stadtschloss bzw. Humboldtforum zu errichten.
Bemerkenswert: Zu diesem Zeitpunkt (also kurz vor seinem Abriss!) war der Palast bereits vollständig asbestfrei entkernt (1998–2003) und damit problemlos sanier- und nutzungsfähig. Dazu lagen mehrere konkrete Umbau- und Nutzungskonzepte vor (u.a. Mehrzweckkulturhaus, Bundestags-Ausweichsitz, modernes Veranstaltungszentrum).
Die Frage war jedoch rein politisch, sein Schicksal längst entschieden:
Mit 385 Ja-Stimmen (vor allem CDU/CSU und große Teile der SPD) gegen 133 Nein-Stimmen (u. a. Die Linke und Teile der Grünen) entschied das Parlament bewusst gegen die Weiterführung eines öffentlichen Kultur- und Begegnungsortes, der tief in der DDR-Alltagsgeschichte verankert war.
Ostdeutsche Abgeordnete stellten nur einen verschwindend geringen Teil des Parlaments – und viele von ihnen stimmten gegen den Abriss. Die Zustimmung kam vor allem von Fraktionen, die bereits Anfang der 1990er Jahre das Ziel formuliert hatten, "bauliche Relikte der DDR aus dem Zentrum zu entfernen.". Man hatte Berlin wiedergewonnen und war gewillt, sie auch optisch zur Hauptstadt der BRD zu machen. Elementare, repräsentative Bauwerke der DDR an zentralen Orten standen im Widerspruch zu diesem "Sieg". Die BRD-Regierung und die westdeutschen Abgeordneten wollten an dieser Stelle nicht an die soziale Urbanität der DDR erinnern – sondern ganz offenbar ein neues historisches und ideologisches Zentrum setzen.
🌙 Was verloren ging
Mit dem Palast verschwand:
- ein Ort, an dem man sein durfte, ohne zu konsumieren
- ein Ort, an dem Kultur nicht selektierte
- ein Gebäude, das Stadt als Gemeinschaft organisierte
- ein real existierender Gegenentwurf zur Marktgesellschaft
Der Palast war nicht nostalgische Erinnerung, sondern gelebte Möglichkeit. Und genau deshalb musste er verschwinden.
Übrigens: Alles, was aus dem Palast noch versilbert werden konnte, wurde verkauft. Ein großer Teil der Stahlträger des Palasts wurde beispielsweise 2006–2008 über Zwischenhändler in den Nahen Osten verkauft, darunter Ladenbau- und Hallenstahl, der in Bauprojekten der arabischen Golfregion verwendet wurde. Ein Teil landete als Konstruktionsstahl sogar in Brückenprojekten in den USA.
Mit dem wertvollen Kupfer (über 14 Tonnen!) aus dem Palast wurde richtig Geld verdient. Und das meist unter der Hand...
Schlusssatz
Nach 1990 ging es nicht nur um Stadtplanung. Es ging darum, wer erzählen darf, was Geschichte bedeutet. Die BRD kam nicht als "Einheitspartner", sondern als Siegermacht, die die Regeln des öffentlichen Gedächtnisses neu setzte. In dieser Logik war der Palast der Republik nicht nur ein Gebäude, sondern ein Störsignal: Er erinnerte daran, dass gesellschaftliche Organisation jenseits von Marktlogik bereits real existiert hatte – und funktionierte.
Eine Siegergesellschaft braucht keine Alternative. Sie braucht Bestätigung. Das Zentrum der Hauptstadt musste die eigene Erzählung spiegeln. Nicht Offenheit, sondern Triumph.
Deshalb kehrte das feudale Stadtschloss zurück. Nicht aus "Traditionspflege", sondern als architektonische Siegerpose: Ein Gebäude, das nicht erlebte Gemeinschaft repräsentiert, sondern die Ordnung, in der oben und unten wieder klar definiert sind.
Abbildung: "Die DDR hat's nie gegeben". So ein treffendes Graffiti auf den Abrissruinen des Palasts (Foto: Rudolf Denner)











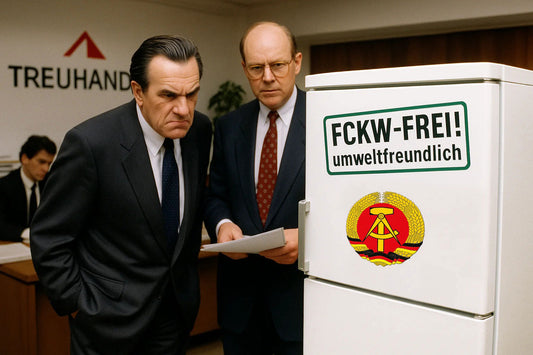








25 Kommentare
Es war und ist eine feindliche Übernahme und eine gesellschaftliche Konstruktion, die wir im Osten nicht wollten. Gemeinschaft und Zusammenhalt solle es nicht mehr geben. Durch die Spaltung der Menschen hat man einen möglichen Widerstand gegen “Ungereimtheiten”, Willkür, Korruption und Diktat fast verunmöglicht. Unsere Brüder und Schwestern in den gebrauchten Ländern wurden über Jahrzehnte geprägt und das Ergebnis sehen wir heute. “Unsere Demokratie.” Der Osten muß es wohl erneut richten! Wir danken Euch für Eure Recherchen und Aufzeichnungen.
Ich denke die wollen einfach nur all das auslöschen was an die DDR erinnert,so sollen jetzt sogar Straßennamen wie Karl Marx umbenannt werden.Damit wird vielen Menschen die persönliche Biographie aberkannt .
Alles zum Wohle des Werte-Westen .
Vielen Dank für diesen Beitrag. Es hat mich sehr traurig gemacht, die Vergangenheit so noch mal betrachtet zu haben. Ich war auch mal im Palast der Republik und dieser Besuch erfüllte mich mich Stolz. Der Abriss des Gebäudes erschütterte mich damals sehr. Ich konnte es einfach nicht glauben, dass ausgerechnet der Palast voll Aspest gewesen sein sollte! Der Artikel hat mir die Augen geöffnet!
Die systematische Auslöschung unserer DDR- Geschichte ist Systembedingt. Ich war und bin gerne ein Kind der DDR und bin Stolz darauf!
Baujahr 1963 ,Sachse ,ein Kind der DDR. Alles mit erlebt vom Kiga über Polytechnische OS,Facharbeiter und natürlich NVA und jetzt fast Rentner! (Gott sei Dank)
Die Bilder wecken Erinnerungen in mir hervor,die es so schon über 35 Jahre nicht mehr
gibt. Waren im Jahr paar Mal in der Hauptstadt der DDR und deckten uns mit allerlei Dingen des täglichen Bedarfs ein .
Mit dem zeitlichen Abstand der Wiedervereinigung (Annexion ?) von heute mache
ich ein grosses Fragezeichen dahinter ,ob das jetzt wie sich alles Entwickelt hat, der bessere Staat ist. Dieses Land ist tief gespalten in Ost bzw West.
Wenn mein Enkel zu mir sagt,Opa ich bin ein Ossi,macht mich das schon Nachdenklich?
Aber auch an Hand des Palastes der Republik und was daraus geworden ist,die ,,Sieger" schreiben
die Geschichte!
Danke! Damit kann ich meinen Kindern und Enkel einen sehr substantiellen Beitrag vorlegen.
(Man erinnert sich ja selbst kaum noch an die (auch ) GUTEN Seiten der Kindheit und Jugend IN UNSEREM Land damals )